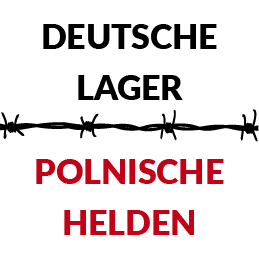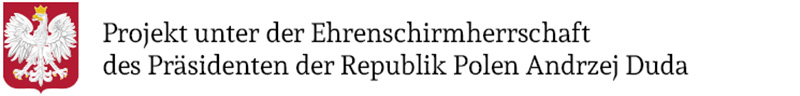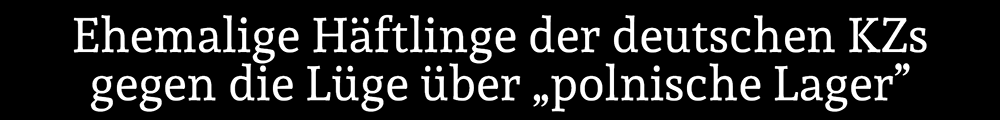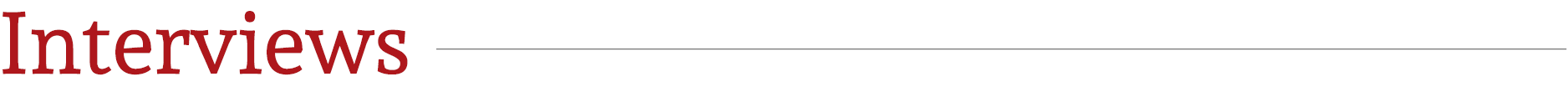Foto Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau
Der Schlüssel zur Verbsserung der Lage liegt in unserer täglichen Arbeit. Ich meine hier die Edukation nicht nur der meinungsbildenden Kreise, sondern vor allem die Aufklärung der Abentausenden von Besuchern des Museums.
Ein Gespräch mit Piotr M.A. Cywiński, dem Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau
Was können wir machen, um gegen den in ausländischen Medien sich wiederholenden Ausdruck «polnische Lager« anzukämpfen?
Meiner Überzeugung nach gibt es diesbezüglich zwei Aktivitäten, die sich bewährt haben und die man fortsetzen sollte. Die eine besteht in der regelmäßgen Zusammenarbeit der Auslandspolen mit der Diplomatie. In vielen Fällen ist der Druck, den die territorialen Gemeinschaften auf einzelne Zeitungen ausüben, erfolgreich. Die andere ist längerfristig und besteht in der konsequenten Bildung.
Das Auschwitz-Museum legt einen großen Wert auf die Aufklärung der Journalisten. Wie ist ihre Wirkung?
Der 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau war das größte mediale Ereignis in der Geschichte des Museums. Aus diesem Anlass haben wir eine umfangreiche Info-Webseite für aus- und inländische Berichtserstatter vorbereitet. Übrigens, wir arbeiten fortlaufend mit den Journalisten aus der ganzen Welt zusammen. Sie werden von uns regelmäßig mit Informationen versorgt. Ich habe keine Zweifel daran, dass dadurch viele dumme und unnötige Fehler vermieden worden sind. Außerdem haben wie die App „Remember” entwickelt. Sie sucht Formulierungen wie etwa «polnische Lager« heraus und empfiehlt einen korrekten Begriff. Dank der App wurde die Sache weltweit bekannt.
Der Schlüssel zur Verbsserung der Lage liegt in unserer täglichen Arbeit. Ich meine hier die Edukation nicht nur der meinungsbildenden Kreise, sondern vor allem die Aufklärung der Abentausenden von Besuchern des Museums. Ich lege große Hoffnung darauf, weil zu uns sehr viele junge Leute kommen. Mir scheint, dass die Situation sich mit der Zeit deutlich bessern wird. Einige Dinge lassen sich nämlich nicht per Gesetz und von heute auf morgen ändern.
Sie haben nun seit zehn Jahren das Amt des Direktors des Auschwitz-Museums inne. Hat sich in dieser Zeit die Situation verbessert?
Nach meinem Dafürhalten ist das Bewusstsein, bezogen auf den Zweiten Weltkrieg und die Konzentrationslager, größer geworden. Die Journalisten, die sich regelmäßig mit dieser Frage befassen, reagieren sensibler, wenn sie der Bezeichnung «polnische Lager« begegnen. Vor zehn Jahren war das nicht der Fall. Sie machten jedes Mal große Augen, wenn man sie auf diesen falschen Begriff hingewiesen hatte. Jetzt geben immer mehr Journalisten zu, sie hätten das Wort falsch oder unpräzise verwendet. Aber ich fürchte, dieser sprachliche Lapsus würde ab und zu vorkommen. Schuld daran ist das hohe Tempo, mit dem die heutigen Medien arbeiten. Alles muss Hier und Jetzt sein, Korrekturlesen in den Redaktionen gibt es kaum. Aber wir setzen alles daran, um dem Problem, über das wir uns unterhalten, vorzubeugen.