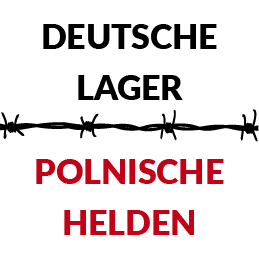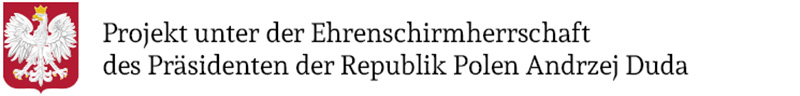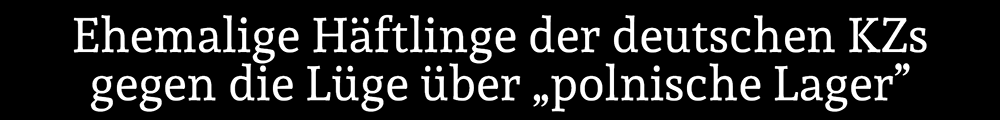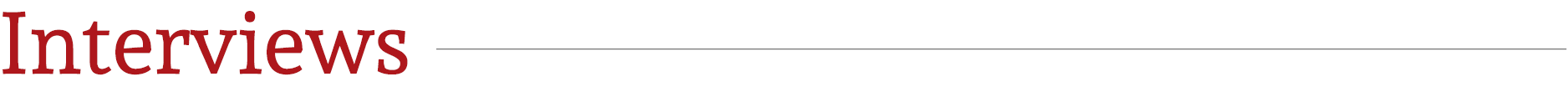Foto MHP/Mariusz Szachowski
Sehr wenige Personen, sogar hierzulande, wissen über deutsche, vor allem für polnische Bevölkerung gedachte Konzentrationslager, wie etwa Mauthausen-Gusen, wo einige tausend Polen, darunter zum großen Teil die polnische Intelligenz, ermordet wurden.
Ein Gespräch mit Robert Kostro, dem Leiter des Museums der polnischen Geschichte (polnisch Muzeum Historii Polski, kurz MHP)
Als US-Präsident Barack Obama den polnischen Untergrundkämpfer Jan Karski posthum mit der Freiheitsmedaille würdigte, sprach er bei der Ehrung von «polnischen Todeslagern«. Sie haben dann sofort reagiert und vom Weißen Haus eine offizielle Entschuldigung gefordert. Was hat Sie dazu bewogen?
Es war ein bisschen anders. Unser Museum der polnischen Geschichte hatte eine große Kampagne gestartet, die Person von Jan Karski im In- und Ausland bekannt zu machen. Dieses Ziel war u.a. durch thematische Ausstellungen, edukative Programme und Erstellung der ihm gewidmeten Websites erreicht worden. Dank seinem Lebenslauf konnten wir Interessierten aus dem Ausland Realien des deutsch besetzten Polen, Errungenschaften des Polnischen Untergrundstaates sowie die Frage der von der polnischen Bevölkerung unternommenen Judenrettung zeigen. Eine von den Aktionen, an denen wir uns mit verschiedenen amerikanischen Partnern beteiligt hatten, bestand darin, Karski – als Kurier der polnischen Widerstandsbewegung und als Augenzeugen des Holocaust – mit der Freiheitsmedaille zu ehren. Die Kampagne war erfolgreich und der damalige polnische Außenminister, Prof. Adam Rotfeld, nahm die Medaille entgegen. Bei ihrer Aushändigung fielen die Worte Obamas von «polnischen Todeslagern«. Infolge dieser missglückten Formulierung hat der US-Präsident sich später beim damaligen polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski per Brief entschuldigt. Aber die Entschuldigung war nur die briefliche Antwort Obamas auf die vorherige schriftliche Dementi-Bitte Komorowskis. Abgesehen davon, haben die Feierlichkeiten im United States Holocaust Memorial Museum sowie der durch den Versprecher Obamas ausgelöste mediale Sturm dazu beigetragen, Karski und den Polnischen Untergrundstaat der Weltöffentlichkeit näherzubringen. Und durch diese spezifische Aufklärung wurde den Amerikanern die Unkorrektheit dieser Formulierung klar.
Wo liegen, Ihrer Meinung nach, Gründe für die Benutzung der Formulierung «polnische Konzentrationslager/polnische Todeslager«, was in den westlichen Medien immer häufiger der Fall ist?
Ehrlich gesagt, gab es solche Formulierungen bereits gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in polnischen Publikationen. Aber damals war für alle klar, wer die Täter waren. Außerdem wurde damals der Holocaust zusammen – und nicht getrennt wie heute – mit anderen Kriegsverbrechen diskutiert. Polen wurde damals als eins der Hauptopfer des Krieges angesehen. In den 1960 und 1970er Jahren begann sich diese Frage zu ändern. Israel und amerikanische Juden haben zunehmend viel daran gesetzt, verschiedene Einrichtungen zu gründen und Handlungen zu betätigen, die die Erinnerungen an die Shoah zum Ziel hatten und die das Wissen darüber weltweit propagieren sollten. Das politisch gesehen hinter dem Eisernen Vorhang befindliche, kommunistische Polen hat dagegen allmählich immer weniger unternommen, für seinen point of view der Geschichte zu werben. Dazu kam noch der historische Diskurs in Deutschland, infolgedessen die Verantwortung für die Verbrechen sich langsam von Deutschland als Staat in Richtung „die Nazis” verschoben hat. Es entstand eine Asymmetrie: einerseits das fortschreitende Unwissen über die polnische Geschichte samt Marginalisierung der polnischen Kriegserfahrungen, andererseits die internationale Bedeutungszunahme des Holocaust und der jüdischen Überlieferung. Aus diesem Grund assoziieren heute viele junge Amerikaner, Franzosen oder Israelis den Ausdruck «polnische Konzentrationslager« mit den mutmaßlichen polnischen Verbrechen, was wiederum ein falsches Bild von Polen als Mittätern des Holocaust zur Folge hat.
Was soll nach Ihrem Dafürhalten unternommen werden, um der in den westlichen Medien gebrauchten Bezeichnung «polnische Konzentrationslager« entgegenzuwirken?
Ich glaube, der beste Weg besteht darin, Fakten zu klären und Berichtigungen zu fordern. Mit solchen schriftlichen Erklärungen und Dementis sollten sich unsere staatlichen Institutionen, die Botschaften und die NGOs beschäftigen. Die zweite wichtige Frage ist die Aufklärungsarbeit. Wir müssen über Kriegserfahrungen, deutsche Besatzung und ferner über den Zweiten Weltkrieg aus polnischer Sicht konsequent informieren. Zum Beispiel unsere „Gerechten unter den Völkern” und unsere großen Helden wie Jan Karski oder Witold Pilecki der Weltöffentlichkeit ins Gedächtnis zurückrufen. Dasselbe soll für das Martyrium der Polen im Zweiten Weltkrieg gelten. Sehr wenige Personen, sogar hierzulande, wissen über deutsche, vor allem für polnische Bevölkerung gedachte Konzentrationslager, wie etwa Mauthausen-Gusen, wo einige tausend Polen, darunter zum großen Teil die polnische Intelligenz, ermordet wurden.
Das Museum der polnischen Geschichte setzt sich sehr aktiv dafür ein, ein Bild von Polen international zu kreieren. Berücksichtigt diese Aktivität einerseits die Erinnerungen an deutsche Verbrechen und auf der anderen Seite Popularisierung der heldenhaften Haltung der Polen im Zweiten Weltkrieg?
Unser Museum hat sich mehrmals an Projekten beteiligt, die Sie an letzter Stelle Ihrer Frage erwähnt haben. Wir haben unter anderem den 100. Geburtstag von Jan Karski feierlich gewürdigt. Zur Zeit engagieren wir uns für Ausstellungs-, Internet- sowie Filmprojekte zur Erinnerung an die polnischen Opfer der Verbrechen im Lager Gusen. Das MHP war darüber hinaus einer der ersten Teilnehmer an der internationalen Internet-Plattform Google Cultural Institute. In diesem Rahmen haben wir Ausstellungen über Jan Karski und Witold Pilecki organisiert und dadurch Millionen von Menschen in einigen Dutzend Ländern erreicht. Ein wichtiges Programm, bei dem wir seit Jahren zusammen mit dem Institut für Spielraum für Bürger und Sozialpolitik (polnisch Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej) mitwirken, ist die Konferenzreihe „Recovering Forgotten Past”. Wir laden amerikanische und angelsäschische Autoren von Hochschullehrbüchern und Publikationen, die über polnische Geschichte und die Geschichte von Mittel- und Osteuropa schreiben, zu uns ein. Im Rahmen der Konferenzen diskutieren unsere Gäste mit polnischen Fachkollegen ihre Texte aus. Bisher ist uns dadurch gelungen, aus über hundert amerikanischen akademischen Geschichtsbüchern Sachfehler, Stereotypen und Verfälschungen zu eliminieren.
Wie sehen Sie die Rolle der Museen und Gedenkstätten, um das westliche Ausland von der Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg in Kenntnis zu setzen?
Die Rolle der Museen ist riesengroß, weil sie mehrdimensional agieren. Sie bereiten Ausstellungen vor, führen Forschungen durch, widmen sich der Edukation und Popularisierung sowie kooperieren mit ausländischen Kunst- und Wissenschaftsorganisationen. Das Museum des Warschauer Aufstandes, Museum der Geschichte der polnischen Juden, Auschwitz-Museum und andere Märtyrer-Museen haben eine doppelte Funktion. Einerseits fungieren sie als wichtige touristische Ziele für In- und Ausländer. Andererseits spielen sie eine aktive Partnerrolle bei internationalen Projekten aller Art. Sie sind ebenfalls Ansprechpartner für ausländische Medien und Filmemacher, die sie konsultieren wollen und/oder um historische Dokumente sowie Requisiten ersuchen. Eine besondere Rolle bei der Berichtigung der Geschichtsfälchung spielen in Kürze das Museum des Zweiten Weltkriegs wie das Museum der polnischen Geschichte. Diese zwei Einrichtungen beabsichtigen Handlungen zu starten, die das Bild Polens im Zweiten Weltkrieg ins rechte Licht rücken.