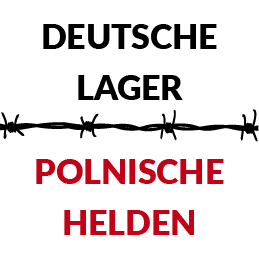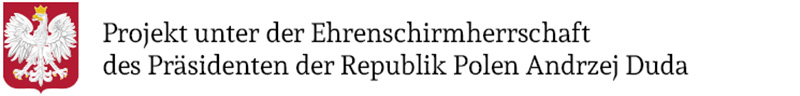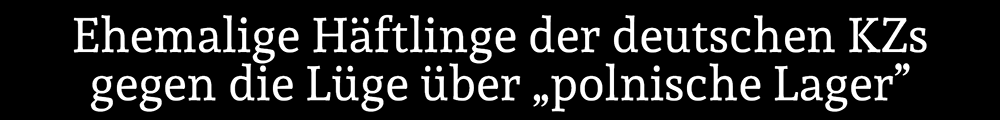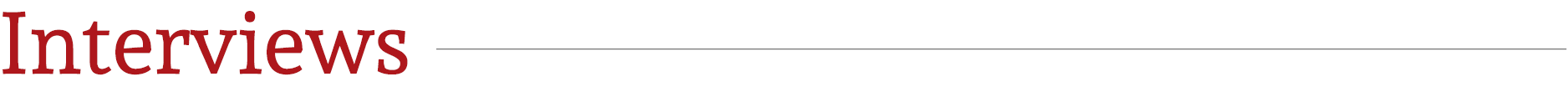Foto: das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau
Ich persönlich wurde mit der Frage konfrontiert, wie wir Polen, die hier im Auschwitz Museum arbeiten, uns mit dem Gedanken fühlen würden, für diese Greueltaten zuständg gewesen zu sein. Diese Ignoranz zeigt, wie viel Aufklärungsarbeit uns noch bevorsteht.
Ein Gespräch mit Andrzej Kacorzyk, dem Leiter des Internationalen Bildungszentrums über Auschwitz
Kennen die ausländischen Besucher des Auschwitz-Museums die Geschichte dieses Ortes?
Das Museum wird von Personen mit sehr unterschiedlichen Kenntnissen über den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besetzung Polens besucht. Das größte diesbezügliche Bewusstsein besitzen Europäier und Israelis. Die meisten Besucher aus den vom Krieg betroffenen Ländern orientieren sich ebenfalls mehr oder weniger gut, was in Auschwitz passiert ist. Aber bedauerlicherweise fragen auch sie manchmal, wer für die Verbrechen im Lager verantwortlich war. Ich persönlich wurde mit der Frage konfrontiert, wie wir Polen, die hier im Auschwitz Museum arbeiten, uns mit dem Gedanken fühlen würden, für diese Greueltaten zuständg gewesen sind. Diese Ignoranz zeigt, wie viel Aufklärungsarbeit uns noch bevorsteht.
Wie sorgt das Museum dafür, damit die Besucher keine Zweifel hätten, wer die Täter und wer die Opfer waren?
Die Schlüsselrolle spielt hier die meritorische wie didaktische Ausbildung der Mitarbeiter des Besucherdienstes. Jede Gruppe bekommt einen Führer, der nicht nur das Wissen vermittelt, sondern auch im Stande ist, aufkommende Fragen und Zweifel zu beantworten und zu klären.
Die Mitarbeiter des Besucherdienstes verfügen über Sprachkenntnisse von insgesamt 18 Fremdsprachen. Die meisten Besucher können wir also über die Geschehenisse in Auschwitz in ihrer Muttersprache informieren. Bei den Führungen kümmern wir uns auch um die Exaktheit der vermittelten Botschaften. Das erreichen wir z.B. dadurch, dass – bei bestimmten Termini – ein deutsches Vokabular, sozusagen «Originalsprache« verwendet wird. Da wird den Besuchern eindeutig klar, wer das Lager verwaltet hat sowie für die Verbrechen verantwortlich war. Unsere Fremdenführer werden sensibilisiert, unpersönliche Ausdrucksweise zu vermeiden. Statt den Passivsatz «das Gas wurde in Gaskammern reingeworfen«, der die Täter nicht explizite nennt, empfehlen wir «Die SS-Männer haben das Zyklon B in die Gaskammern reingeworfen« zu gebrauchen.
Was unternehmen Sie noch, um das Wissen über die Geschichte von Auschwitz der Allgemeinheit nahezubringen?
Wir planen einen neuen Sitz des Internationalen Bildungszentrums über Auschwitz bauen zu lassen. Es liegt uns viel daran, einen Ort zu schaffen, wo man den Besuch in Auschwitz zusammenfassen könnte. Wir wollen nicht – wie das jetzt der Fall ist – dass die Besucher gleich nach der Besichtigung der Gaskammern direkt wieder in den Alltag übergehen und das Gesehene nur mit vorübergehenden Emotionen endet. Wir brauchen eine Stelle, die einen Gedankenaustausch ermöglichen und zum Nachdenken anregen würde. Dadurch wird die Erfahrung, die die Besucher in Auschwitz machen, von längerer Dauer sein.
Das Bildungszentrum über Auschwitz bemüht sich außerdem ständig, sich mit seinem Angebot weltweit zu etablieren. Das bedeutendste Werkzeug dazu ist das Internet, das ermöglicht, neues Publikum zu gewinnen. Die Südamerikaner beispielsweise besuchen uns selten live, sondern sehr oft über unsere Webseite.
Warum taucht also, trotz all dieser Bemühungen, die Fomrulierung «polnische Lager« so oft auf?
Ich glaube, in vielen Fällen resultiert das einfach aus einer Gedankenlosigkeit. Viele ehemalige deutsche Lager liegen heutzutage in Polen, also kommt es zu einem Gedankenkürzel und nun heißt es «polnische Lager«. Ich meine auch, dass gewisse, auf den polnischen Antisemitismus bezogene Stereotypen, eine große Rolle spielen. Aber man muss sich vor Augen führen, warum Hitler gerade Polen zum Zentrum der Judenvernichtung gewählt hat. Nicht deshalb, weil wir Antisemiten oder gar Mittäter waren, sondern weil hierzulande vor dem Krieg sehr viele Juden gewohnt hatten – insgesamt machten sie 10 Prozent Bürger der Zweiten Polnischen Republik aus.