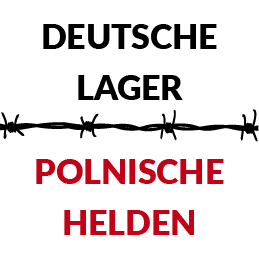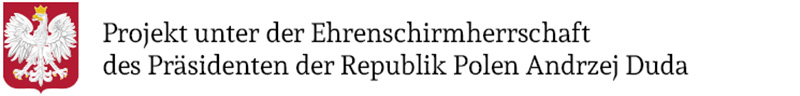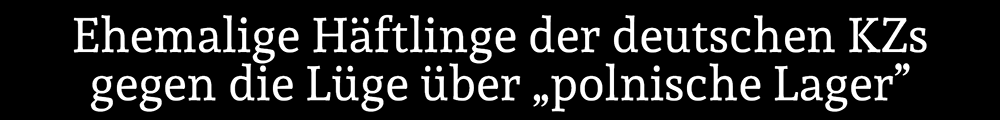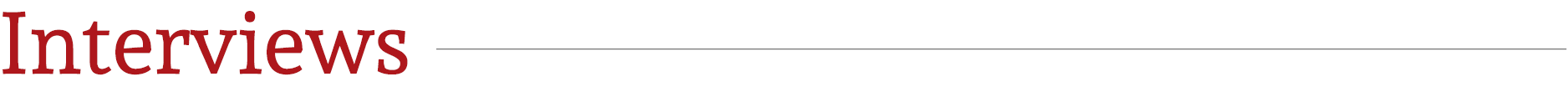Foto Michał Radwański/Ośrodek KARTA
Wäre die Geschichte Polens allgemein bekannt, würde es niemand wagen, deutsche Lager als «polnische« zu bezeichnen.
Ein Gespräch mit Zbigniew Gluza, dem Vorsitzenden des KARTA Zentrums, das sich mit Dokumentation und Popularisierung der jüngsten Geschichte Polens befasst
Warum kennt die Welt die Geschichte Polens im Zweiten Weltkrieg so wenig?
Weil das Wissen über diese Zeit über zwei Narrationen, die westliche und die postsowjetische, verbreitet wird. Der Westen machte allmählich den Holocaust zum Hauptelement seiner Beschreibung dieser Zeit und berücksichtige dabei kaum die riesengroßen Repressalien, die im Krieg die ganze polnische Nation getroffen hatten. Polen wurde in dieser Überlieferung ausgeblendet, wahrscheinlich wegen der Schuldgefühle unserer ehemaligen West-Alliierten, die uns im Laufe des Krieges im Stich gelassen hatten. Viel mehr empörend ist jedoch die Tatsache, dass man die sowjetische Narration würdigt, in der der Kremel als Verbündeter des Westens im Kampf gegen den Nationalsozialismus dargestellt wird und nicht wie der Aggressor, der gleichermaßen am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verantwortlich war. Die Sowjets begangen im Krieg ähnliche Verbrechen, wie sie vorher bei sich 1937-38, als der Höhepunkt des großen Terrors erreicht wurde, verübt hatten.
Und was ist mit der polnischen Überlieferung?
Wir waren leider nicht im Stande, uns mit unseren Erfahrungen mit diesen zwei totalitären Systemen in der Weltöffentlichkeit durchzusetzen. Mit den Erfahrungen, die politische Unabhängigkeit Polens – aber zum Glück nicht unsere nationale Identität – für ein halbes Jahrhundert weggenommen haben.
Warum?
In den 1990er Jahren waren alle unsere Politiker davon überzeugt, dass die Geschichte keine Rolle spielt. Dass sie unser Land, seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eher schwächen und politische Beziehungen mit unseren Nachbarn erschweren würde. Unser KARTA Zentrum hat als eine NGO-Organisation, die sich mit der jüngsten Vergangenheit beschäftigt, das ganze Jahrzehnt dagegen anzukämpfen versucht. Leider erfolglos. Der polnische Staat hat in dieser Hinsicht längerfristig nichts unternommen.
Trotz späterer institutioneller Veränderungen fehlt immer noch die vollständige Historiographie aus polnischer Perspektive, die wir der Welt präsentieren könnten. So wurden z.B. die Folgen des Überfalls auf Polen bis heute nicht genügend vorgestellt.
Hören wir aus diesem Grund so oft die Formulierung «polnische Lager«?
Das ist eine der Konsequenzen der grundsätzlichen Versäumnisse. Wäre die Geschichte Polens allgemein bekannt, würde es niemand wagen, deutsche Lager als «polnische« zu bezeichnen. Es ist höchst irritierend, dass einem Land, dass im Zweiten Weltkrieg mit ungeheueren Massenverbrechen konfrontiert wurde, nahegelegt wird, es habe damals eine institutionelle Gewalt ausgeübt. Von den 35 Mio. Bürgern der Zweiten Polnischen Republik wurden 1939-45 gegen mindestens 12 Mio. direkt Repressionen angewandt.
Warum können wir uns der Verbreitung dieser Lüge nicht erfolgreich widersetzen?
Weil es nicht reicht, nur zu reagieren und zu protestieren, dass der Begriff «polnische Lager« absurd und verworfen ist. Das sind reaktive, auf lange Sicht nicht erfolgreiche Schritte. Selbst wenn jemand sich dafür vorläufig entschuldigt, wird er den Fehler wieder begehen. Diese «Versprecher« ergeben sich nicht nur aus Ignoranz. Einige wollen auf Polen die Verantwortung für die Kriegsverbrechen abwälzen. Wir haben aber diesbezüglich eine präventive Maßnahme ergriffen: im Verlag des Instituts für Nationales Gedenken erschien vor kurzem das Album Gesichter des Totalitarismus (polnisch Oblicza totalitaryzmu). Fürs Erste auf Polnisch, aber seine fremdsprachlichen Ausgaben können bewirken, dass die Denkweise des Auslands, was die Problematik betrifft, sich ändert.